Fünf Jahre Corona: „Am stärksten belastet war die Generation 40 plus“
Am 22. März 2020 begann der erste deutschlandweite Corona-Lockdown – ein zuvor unvorstellbarer Eingriff in die Freiheit der Menschen. Fünf Jahre später spaltet der Umgang mit der Pandemie noch immer das Land. Während in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem Kinder und Jugendliche als Leidtragende der Coronamaßnahmen gelten, widerspricht Generationenforscher Rüdiger Maas im Interview vehement: Eine andere Altersgruppe wurde psychisch deutlich stärker belastet. Zudem sieht er auch einige klare Gewinner der Pandemie.
MOPO: Herr Maas, vor fünf Jahren begann der erste Corona-Lockdown, der vielen Menschen sehr viel abverlangt hat. Heute aus dem Rückblick: Wen haben die Maßnahmen am härtesten getroffen?
Rüdiger Maas: Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es nicht die junge Generation ist, die psychisch am stärksten belastet war – sondern eher die Generation 40 plus. Also Menschen, die Familien haben oder gerade dabei waren, ein Haus abzubezahlen, die sich um ihre wirtschaftliche Existenz Sorgen gemacht haben.
In der Öffentlichkeit entstand meistens der Eindruck, vor allem die junge Generation leidet. So waren bundesweit Schulen beispielsweise mehr als 180 Tage geschlossen …
Ja, aber man muss natürlich differenzieren. Es kommt stark darauf an, in welcher Phase die Lockdowns die jungen Menschen getroffen haben. Wer gerade eingeschult wurde, kurz vor dem Abitur stand oder eine Ausbildung begonnen hat, der hatte Probleme – teilweise entstanden in der Zeit Lernlücken, die sich nicht mehr so leicht aufholen ließen. Aber auch da gibt es Unterschiede. Die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern stand vor größeren Problemen als Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Die Pandemie wirkte wie ein Brennglas: Wer es vorher schon schwer hatte, der hatte es noch schwerer.
Die Mehrheit der Jungen ist längst weitergezogen
Trotzdem haben jüngere Menschen insgesamt keine so großen psychischen Belastungen erlebt?
Ja, Sie sehen das auch an der Forderung nach „Aufarbeitung“ der Corona-Pandemie. Diese wird auch vor allem von der Generation 40 plus erhoben. Die jungen Menschen sind in ihrer übergroßen Mehrheit längst weitergezogen. Sie haben es überwunden, dass sie damals offiziell keine Partys feiern konnten. Wenn die Elterngeneration und die Medien ihnen aber immer wieder einredet, „Ihr habt die beste Zeit eures Lebens verpasst“, zeigt das bei einigen am Ende Wirkung.
Hat die Pandemie eigentlich auch Gewinner produziert?
Oh ja, viele! Beispielsweise Verschwörungstheoretiker, die mit ihren Büchern und Videos Millionen verdient haben. Dann natürlich Digital-Unternehmen wie Amazon. Und dass es heute möglich ist, auch im Homeoffice zu arbeiten, wäre ohne die Pandemie wohl in vielen Firmen kaum möglich gewesen. Ich betrachte das als gesamtgesellschaftlichen Gewinn.
Im Norden war die Akzeptanz größer als im Süden
Hat die Politik genug auf die Wissenschaft gehört während der Pandemie?
Wir haben nicht unbedingt viele Wissenschaftler in der Politik. Wissenschaftler wie Christian Drosten oder RKI-Chef Wieler mussten einem Gesundheitsminister Jens Spahn erst einmal erklären, was vor sich geht. Und der musste es dann wiederum der Bevölkerung erklären. Dabei ist viel passiert, was man „Übersetzungsfehler“ nennen könnte. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass diejenigen Menschen, die stärker wissenschaftlich geprägt sind, auch die teilweise überraschenden Wendungen während der Pandemie nachvollziehen konnten.
Ein großer Teil der Menschen konnte das aber nicht und hat sich sogar gegen vergleichsweise harmlose Maßnahmen wie Maskentragen gewehrt …
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass es ein Gefälle gab: Im Norden wurden die Maßnahmen der Politik stärker akzeptiert als im Süden. Und im Westen besser als im Osten.
Das Vertrauen ging bei vielen schon 2015 verloren
Warum hat die Politik viele Menschen nicht erreicht?
Viele Menschen blicken auf die Politik während der Corona-Pandemie eher emotional als rational. Emotional kann ich Dinge aber nur vermitteln, wenn ich Vertrauen genieße. Das war bei Ex-Kanzlerin Angela Merkel bei vielen Menschen zur Corona-Zeit schon nicht mehr der Fall. Sie hatte in diesen Milieus bereits wegen ihrer Flüchtlingspolitik 2015 viel Vertrauen verloren. Unsere Befragungen haben gezeigt: Migrations-Kritiker und Kritiker der Corona-Maßnahmen waren in der Regel derselbe Menschenschlag. Diese Menschen lassen sich auch heute nur noch schwer „zurückholen“, es ist fast unmöglich, mit ihnen über Fakten zu sprechen. Sie haben ihre ganz eigene Sprache und ihre ganz eigenen Deutungen.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert nun eine „Aufarbeitung“ der Corona-Zeit. Halten Sie das für sinnvoll?
Ich stolpere immer ein bisschen über dem Begriff „Aufarbeitung“. Da schwingt die Unterstellung mit, es habe in der Corona-Zeit systematische Verbrechen gegeben. Absichtliches Fehlverhalten der Politik sehe ich aber nicht. Und es macht auch keinen Unterschied, ob das Virus aus dem Labor oder doch von einer Fledermaus kam. Unsere Abläufe in der Politik sind eigentlich nicht darauf ausgerichtet, im Wochentakt schnelle Entscheidungen zu fällen. Ich habe vor allem eine gewisse Überforderung auch der Politiker wahrgenommen.
Die Kommunikation muss sich deutlich verbessern
Was müssen wir aus der Corona-Pandemie für die Zukunft lernen?
Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat einmal gesagt: „Die Geschichte lehrt uns, dass wir nichts aus der Geschichte lernen.“ Aber ich will es positiv wenden: Die Kommunikation muss viel besser werden! Die Emotionen der Menschen müssen stärker berücksichtigt werden. Viele Menschen hatten tatsächlich Angst. Darauf ist nicht ausreichend eingegangen worden. RKI-Chef Lothar Wieler beispielsweise, der seine Einschätzungen sehr trocken und roboterhaft vorgetragen hat, hat viele Menschen eben nicht abgeholt. Das gelang beispielsweise dem Berliner Intensiv-Pfleger Ricardo Lange, der u.a. emotionale, aber wirklichkeitsnahe Erklär-Beiträge in den sozialen Medien veröffentlichte, sehr viel besser.
Noch etwas?
Nötig wäre es auch, die sozialen Medien besser zu regulieren. Dort wurden zur Corona-Zeit massenhaft „Fake News“ verbreitet und teilweise haben die Menschen dort Ideologen Glauben geschenkt, die erkennbar Unsinn verbreiteten. So etwas untergräbt auch das Vertrauen in den Staat. Die Politik braucht ein höheres Vertrauen in die Gesellschaft und andersherum. Es braucht so viel Vertrauen, dass Menschen sagen können: „Ich verstehe zwar nicht genau, was vor sich geht, aber ich vertraue dem Kanzler.“ Das war bei Corona nicht gegeben.

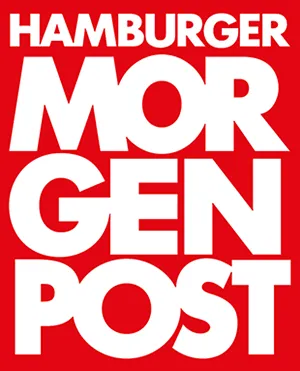

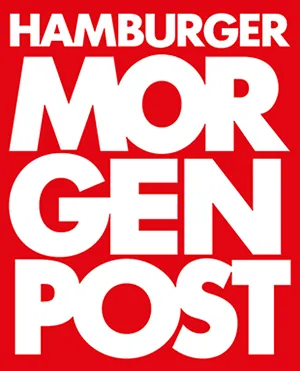
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.